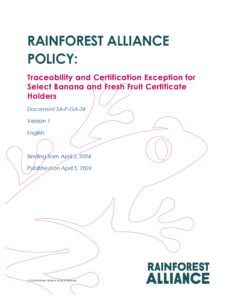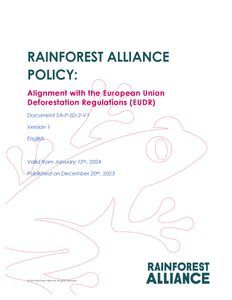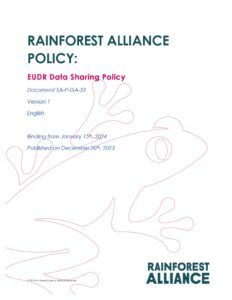Policy: Traceability and Certification Exception for Select Banana and Fresh Fruit Certificate Holders
This policy exception has been developed to streamline the traceability reporting process, allowing offshore supply chain actors to be exempted from traceability and to simplify the certification... View more
Wie viel kostet die Zertifizierung der Rainforest Alliance?
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Zertifizierungskosten für ErzeugerInnen und Unternehmen.
Find An Authorized Certification Body
Rainforest Alliance certification is carried out by our authorized certification bodies. Find an authorized certification body in your county.
Harmonisierung mit der Verordnung der Europäischen Union zur Vermeidung von Entwaldung (EUDR)
Die Europäische Union (EU) hat die Verordnung der Europäischen Union zur Vermeidung von Entwaldung (EUDR) eingeführt, die für einige Produkte, die in die EU importiert werden, Anforderungen an die... View more
Richtlinie für den Datenaustausch gemäß EUDR
Die Europäische Union (EU) hat die Verordnung der Europäischen Union zur Vermeidung von Entwaldung (EUDR) eingeführt, die für einige Produkte, die in die EU importiert werden, Anforderungen an die... View more
Wie die Rainforest Alliance die EUDR-Compliance vom landwirtschaftlichen Betrieb bis zum Einzelhändler unterstützt
Erfahren Sie, wie unsere Instrumente und Angebote darauf ausgelegt sind, zertifizierten Partnern in der Lieferkette Kakao und Kaffee dabei zu helfen, Konformität mit den EUDR-Anforderungen darzulegen.